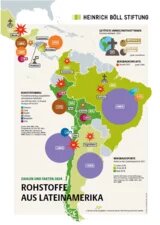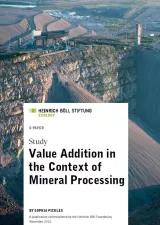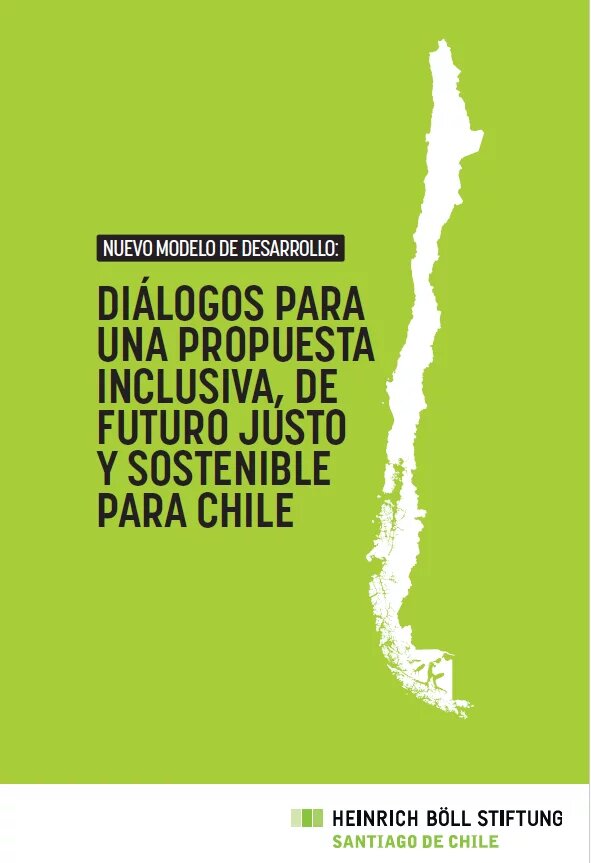
Die Autor*innen eröffnen mit diesem Band die Debatte über ein neues Entwicklungsmodell für Chile, das neben ökonomischen und sozialen auch die ökologischen Komponenten für zukunftsorientierte Rohstoff-, Energie- und Umweltpolitiken umfasst. Anlässlich des Besuchs von Chiles Präsident Gabriel Boric am 11. Juni 2024 in Berlin überreichte ihm Vorstand Imme Scholz die vom Büro Santiago de Chile herausgegebene Publikation.

Warum sprechen die Heinrich-Böll-Stiftung und ihre Partner*innen von einem neuen Entwicklungsmodell für Chile?
Als jüngster Staatspräsident in der Geschichte Chiles ist Gabriel Boric im März 2022 mit einer progressiven und ambitionierten Agenda für die sozial-ökologische Transformation angetreten, unter Einbeziehung umwelt-, sozial- und energiepolitischer Dimensionen. Auf der Agenda der Regierung steht beispielsweise, die Umweltinstitutionen zu stärken, Biodiversität zu erhalten, Umweltaktivist*innen besser zu schützen sowie die Klimakrise zu bekämpfen.
Öffentlich wird in Chile gegenwärtig noch zu wenig über die sozial-ökologische Transformation debattiert. Die Klimakrise ist zwar für alle Chilen*innen sichtbar, etwa durch verheerendere Dürren, jährlich zunehmende Waldbrände und Extremwetterereignisse, die das Land beuteln. Handlungsvorschläge gegen diese katastrophalen Entwicklungen setzen sich bisher jedoch nicht durch. Das liegt zum einen daran, dass Gabriel Boric im Parlament nicht auf eine stabile politische Mehrheit setzen kann. Zum anderen, weil das große Transformationsprojekt des ersten Verfassungsprozesses gescheitert ist. Es war ein Versuch die Barrieren abzubauen, die unter dem Diktator Augusto Pinochet in der Verfassung für staatliches und politisches gemeinwohlorientiertes Handeln verankert worden waren. Unter der Diktatur von General Pinochet war Chiles Wirtschaft radikal liberalisiert und auf den Export von wenig verarbeiteten Rohstoffen umorientiert worden. Das brachte und bringt große Umweltschäden und Lasten für lokale und indigene Gemeinschaften mit sich. Außerdem ist es Chile seit der Redemokratisierung ab dem Jahr 1990 nicht gelungen, seine Wirtschaft strukturell zu modernisieren und in technologisch anspruchsvolle Wertschöpfungsketten zu integrieren, mit entsprechend besser bezahlten Arbeitsplätzen.
Die Arbeit der Heinrich-Böll-Stiftung mit Partnerorganisationen in Chile setzt deswegen auch etwas grundsätzlicher bei der Frage nach einem neuen Entwicklungsmodell für Chile an. Es soll auch helfen, Kräfte für eine sozial-ökologische Transformation zu bündeln, die Umwelt zu schützen, nachhaltige Wirtschaftspraktiken zu fördern und die Demokratie und Menschenrechte zu stärken. Damit kann auch eine solide politische Alternative unterstützt werden, die ultrarechten und rechts-konservativen Strömungen entgegentritt und eine Grundlage für den Wandel schafft, der nicht ohne Reibung und Kosten möglich ist.
Es geht somit um ein Modell, das auf die Chancen für das Land im globalen post-fossilen Zeitalters setzt, um chilenische Rohstoffe vor Ort weiter zu verarbeiten und mit den Einnahmen soziale Gerechtigkeit und Teilhabe zu fördern. Die Vorkommen an Kupfer und Lithium sowie die großen Wind- und Solarenergiepotenziale für grünen Wasserstoff sollen nicht nur für den einfachen Export genutzt werden, sondern auch der Wertschöpfung vor Ort dienen. Gleichzeitig müssen Abbau und Verarbeitung an ökologische und soziale Standards gebunden werden. Dadurch wird auch die Demokratie gestärkt: indem die Menschen mitentscheiden können und erfahren, wie sie von der Umsetzung sozialer und ökologischer Auflagen profitieren. Mit ihren Partner*innen möchte die Heinrich-Böll-Stiftung neue Vorschläge dafür auf die politische Agenda setzen und Transformationsszenarien in neuen und verständlichen Formaten präsentieren. Diese Vorschläge werden partizipativ entwickelt. Nur unter Beteiligung und mit einer Vielfalt von Perspektiven in der öffentlichen Debatte kann eine bessere und in jeder Hinsicht nachhaltige Zukunft für die gesamte chilenische Gesellschaft gestaltet werden.
Wenn es Deutschland und der Europäischen Union gelingt, Chiles Partner in diesem Transformationsprozess zu sein und in diesem Feld mit der privatwirtschaftlichen und wissenschaftlichen Kooperation der Chines*innen in den Wettbewerb zu treten, ist es möglich, dass damit nicht nur wirtschaftliche, sondern auch soziale Ziele erreicht werden und gleichzeitig die Demokratie gestärkt wird.
Neuerscheinung
Anfang Mai 2024 erschien → „Ein neues Entwicklungsmodell: Dialoge zu inklusiven Ansätzen für eine gerechte und nachhaltige Zukunft in Chile“ (Spanisch).
Anlässlich des Besuchs von Gabriel Boric am 11. Juni 2024 in Berlin überreichte ihm Vorstand Imme Scholz die vom Büro Santiago de Chile herausgegebene Publikation. Während seiner Grundsatzrede bei dem Festakt der Böll- und Ebert-Stiftung bezog sich der Präsident auch auf die Publikation als ein Beitrag auf dem Weg zu einer gerechten sozial-ökologischen Transformation. Er betonte: "Chile ist heute ein Partner auf Augenhöhe." In ihren Begrüßungsworten hob Imme Scholz hervor, dass "Europa Partner wie Chile braucht, um die sozial-ökologische Transformation voranzubringen." Das Kapitel “Transformationen sind unvermeidlich – entscheidend ist, sie fair und ökologisch zu gestalten“ ist von Imme Scholz.
Die Autor*innen eröffnen mit diesem Band die Debatte über ein neues Entwicklungsmodell für Chile, das neben ökonomischen und sozialen auch die ökologischen Komponenten für zukunftsorientierte Rohstoff-, Energie- und Umweltpolitiken umfasst. Expert*innen aus Ökologie, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik liefern Beiträge zu den umwelt-, sozial- und energiepolitischen Dimensionen der Transformation. Es entsteht ein umfassendes Bild der Herausforderungen und Chancen, mit denen das Land beim Aufbau eines neuen Modells konfrontiert ist. Dieses Bild soll helfen, eine informierte und partizipative Debatte über Strategien für eine nachhaltige, gerechte und leistungsfähige Wirtschaft zu führen. Das Buch bietet konkrete Vorschläge zur Beförderung der sozial-ökologischen Transformation - etwa Umweltstandards, Besteuerung oder Beteiligung. Darüber hinaus bietet es aber auch Vorschläge zur Lösung von Konflikten, die mit Veränderungen einhergehen können.
Einige Beiträge im Überblick:
-
Vorwort: ein kritischer globaler Rahmen
Hugo Calderón, Soziologe und Wirtschaftswissenschaftler
Calderón analysiert, mit welchen Herausforderungen Chile aktuell politisch, wirtschaftlich und durch die global verheerenden Auswirkungen der Klimakrise konfrontiert ist. Er unterstreicht, wie dringlich das auf fossilen Brennstoffen fußende globale Wirtschaftsmodell ad acta gelegt werden muss, um den Klimawandel einzudämmen. Zudem betont Calderón: Der Übergang zu einer nachhaltigen Entwicklung ist essenziell für die Zukunft des Landes und des Planeten insgesamt. Er zeigt auch auf, welche Aufgaben und Chancen mit dieser Transformation verbunden sind: von der Energiewende bis zur Notwendigkeit, eine gerechtere Verteilung der Einkünfte aus der Ressourcennutzung voranzutreiben.
-
Transformationen sind unvermeidlich – entscheidend ist, sie fair und ökologisch zu gestalten
Dr. Imme Scholz, Co-Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung
Scholz betont in ihrem Beitrag, wie bedeutsam die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen als gemeinsamer globaler Rahmen für eine sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Transformation ist. Trotz der breiten Unterstützung für die Agenda 2030 ist die Staatengemeinschaft von ihrer Umsetzung jedoch weit entfernt, wie die Daten der Vereinten Nationen zeigen. Ursächlich sind unter anderem Rückschläge durch die Corona-Pandemie, die hohe Verschuldung vieler Staaten des globalen Südens und die Auswirkungen langanhaltender Kriege und gewaltsamer Konflikte. Dennoch bleiben die mit der Agenda 2030 einhergehenden Verpflichtungen eine wichtige Grundlage, um eine gerechte Energiewende, den Schutz der Biodiversität und die Reduzierung von Ungleichheiten als tragende Säulen für eine nachhaltige Entwicklung voranzubringen. Unverzichtbar sind dabei auch Strategien, die Synergien zwischen unterschiedlichen Zielen schaffen, um verschiedene Herausforderungen gleichzeitig anzugehen – von der Umstrukturierung der Wirtschaft über den Klimaschutz bis hin zur Förderung von Bildung und der Gleichstellung der Geschlechter.
-
Der Zwiespalt zwischen nachhaltiger Entwicklung und Wirtschaftsachstum
Cristina Dorador Ortiz, Biologin und Doktorin der Naturwissenschaften
Dorador befasst sich am Beispiel der zerstörerischen Auswirkungen des Lithium-Abbaus im Norden Chiles kritisch mit den Widersprüchen des gegenwärtigen Wirtschaftsmodells. Sie plädiert für einen besseren Schutz der Ökosysteme sowie eine aktive Partizipation lokaler Gemeinschaften an Entscheidungen, die ihre Territorien betreffen. Gegenwärtig würden weder die sozialen, noch die ökologischen Auswirkungen des in Chile dominierenden extraktivistischen Wirtschaftssektors beachtet, bemängelt Dorador. Sie unterstreicht die dringende Notwendigkeit, strengere Parameter bei der Umweltfolgenabschätzung anzusetzen.
-
Verfluchter Reichtum. Globale Gier nach natürlichen Ressourcen und ihre ökologischen und sozialen Schäden
Sara Larraín Ruiz-Tagle, Umweltaktivistin und Leiterin der Nichtregierungsorganisation Chile Sustentable
Larraín begrüßt die Verabschiedung des neuen Gesetzes zur Modifizierung und Verteilung von Steuereinnahmen im Bergbau (Ley de Royalty Minero) als einen Schritt in die richtige Richtung. Sie verweist allerdings darauf, dass weitere wichtige Schritte, die eine tatsächlich nachhaltige Entwicklung garantieren, noch ausstehen. So betont Larraín, dass bei Bergbauvorhaben die Rechte der indigenen Gemeinschaften respektiert und die Konvention 169 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO169) eingehalten werden müssten. Zudem fordert sie, den Abbau von Bodenschätzen stärker zu regulieren sowie die Wassergesetzgebung grundlegend zu reformieren, um die Wasserressourcen des Landes zu schützen.
-
Gleichgewicht zwischen Wirtschaft und Umwelt: Chiles Engagement für eine ganzheitliche Entwicklung
Maximiliano Proaño Ugalde, Staatssekretär im Umweltministerium
Proaño präsentiert Strategien der gegenwärtigen chilenischen Regierung, um Wirtschaftswachstum und Umweltschutz miteinander in Einklang zu bringen. Dabei unterstreicht er wie bedeutsam es sei, den Privatsektor in die Energiewende einzubinden. Auch Investitionsprozesse im Bergbau müssten sorgsam geplant werden, um negative soziale Auswirkungen und Umweltfolgen zu reduzieren. Proaño benennt klar die enormen Herausforderungen, vor denen das Land in dieser Transformation steht und betont, wie wichtig ein koordiniertes Vorgehen zwischen Regierung, Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft ist.
-
Energiewende: Das Zeitalter der erneuerbaren Energien
Marcelo Mena Carrasco, ehemaliger Umweltminister, CEO vom Global Methane Hub
Mena beschreibt die Herausforderungen, die der Wandel hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaftsweise in Chile mit sich bringt. Er hebt die Bedeutung einer grünen Steuerreform hervor, die den Wandel mitfinanziert - und plädiert für stärkere Investitionen in eine Speicherinfrastruktur, um das Potenzial der erneuerbaren Energien auszuschöpfen. Mena spricht sich für eine Politik des sozialen Ausgleichs aus, um nachteilige Effekte zu minimieren, die mit der Transformation einhergehen und besonders vulnerable Sektoren der Gesellschaft treffen.
-
Kohlenstoffneutralität: Strategischer und institutioneller Rahmen
Claudio Maggi, Mitglied der Geschäftsführung von CORFO
Maggi beschreibt die Instrumente, die Chile für die klimaneutrale Produktionsförderung zur Verfügung stehen, etwa mit Blick auf Lithium oder grünen Wasserstoff. Er hebt die Rolle der chilenischen Behörde zur Förderung der Produktion CORFO (Corporación de Fomento de la Producción) als wichtigster Entwicklungsgesellschaft des Landes hervor sowie deren Verpflichtung zu Nachhaltigkeit in den Bereichen Wirtschaft, Soziales und Umwelt. Maggi unterstreicht zudem, wie bedeutsam der Ausbau alternativer Energiequellen aus erneuerbaren Energien sowie die Unterstützung der Schlüsselbereiche der Produktion bei der Energiewende für die Wirtschaft des Landes sind.
-
Energiewende: Die besonderen Bedingungen in Chile
Ana Lía Rojas, Geschäftsführerin von ACERA (Verband der Unternehmen im Bereich erneuerbarer Energien und Speicherung)
Rojas analysiert die regulatorischen Herausforderungen auf dem chilenischen Strommarkt im Kontext der Energiewende. Sie spricht sich für eine Regulierung aus, die erneuerbare Energien fördert und die Diversifizierung des Energiemarktes im Land unterstützt. Rojas plädiert für einen regulatorischen Rahmen, der private Investitionen in saubere und nachhaltige Energien gezielt fördert und dabei die soziale Situation der lokalen Gemeinschaften und Territorien im Blick behält.
-
Die langfristige Entwicklung der chilenischen Wirtschaft und die sozial-ökologischen Herausforderungen
Gonzalo D. Martner, Ökonom
Martner untersucht, wie sich Chile seit 1960 wirtschaftlich entwickelt hat. Er schlägt Maßnahmen vor, um grüne Investitionen zu erhöhen und öffentliche Ausgaben gerechter zu verteilen. Investitionen in die grüne Infrastruktur müssten wachsen sowie die Regionalplanung gefördert werden, um im ganzen Land eine nachhaltige und sozial gerechte Entwicklung garantieren zu können. Martner plädiert für eine progressive Steuerreform, die für steigende Staatseinnahmen sorgt. So könnten Entwicklungsprogramme für den sozialen und den Umweltbereich finanziert werden.
Hier finden Sie weiterführende Informationen auf Spanisch.
Einen Ausschnitt aus der oben erwähnten Grundsatzrede von Gabriel Präsident Boric finden Sie hier (Spanisch)