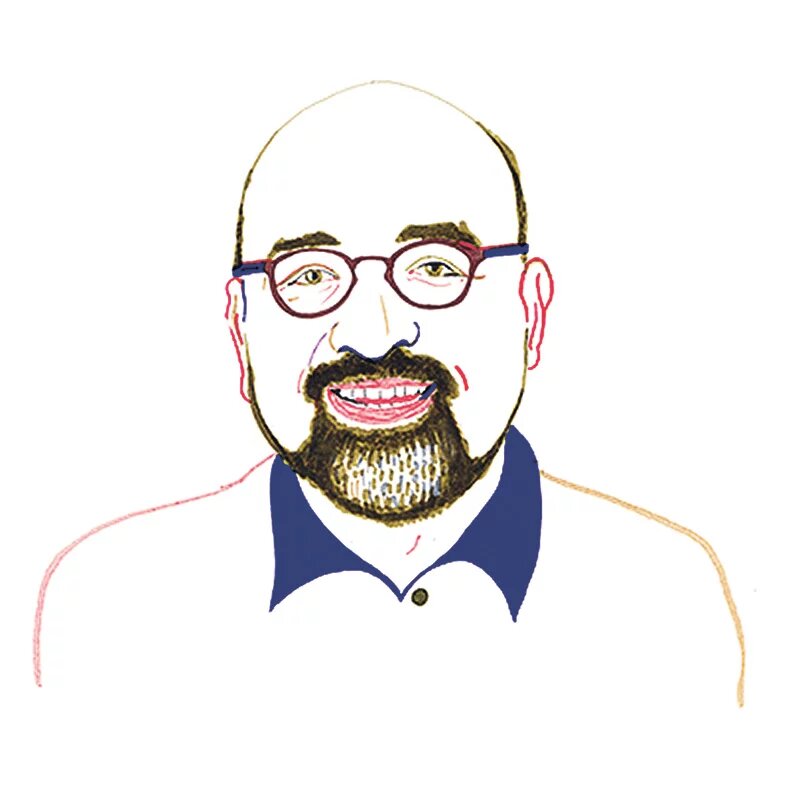Frau Donfried, Herr Nouripour, wie steht es um die europäisch-amerikanische Freundschaft im Zeitalter von Donald Trump?
Karen Donfried (KD): Sie ist immer noch sehr bedeutend für beide Seiten. Aber es ist alles viel emotionaler als früher. Wir haben jetzt einen Präsidenten, der findet, dass Europa Amerika unfair behandelt. Auch, wenn er in manchen Punkten recht hat – Stichwort Verteidigungsausgaben –, ist die Art, wie er mit unseren Freunden umgeht, sehr ungewöhnlich. Man sieht, wie stark das Vertrauen zwischen beiden Seiten schwindet, und die Corona-Krise macht es noch schwieriger.
Omid Nouripour (ON): Wir dürfen eins nicht vergessen: Es gibt in den USA eine Zivilgesellschaft, die mit uns reden will. Die viele ähnliche Interessen hat wie wir, die viele unserer Werte teilt. Das kriegt auch kein Präsident kaputt. Was mich bedrückt, sind gar nicht unbedingt politische Differenzen in bilateralen Gesprächen, sondern es ist der Zustand der amerikanischen Innenpolitik. Der Umgang zwischen Demokraten und Republikanern und diese Sprachlosigkeit, die da herrscht, tragen sich weiter in die transatlantischen Beziehungen, und das schadet der Zusammenarbeit am Ende mehr als ein Streit über Inhaltliches.
Sollte Europa sich stärker auf sich selbst besinnen?
ON: Das sollte es, und zwar im doppelten Sinne. Einerseits insofern, als wir uns auch an die eigene Nase fassen müssen, anstatt immer nur über die anderen zu lästern. Im Juni 2017 bin ich nach West Virginia in den Wahlkreis gefahren, in dem Trump bundesweit die meisten Stimmen bekommen hatte. Es gab dort keinen Arzt, keine gescheite Wasserversorgung, als gastronomisches Angebot eine einzige McDonald’s-Filiale. Ich habe mir vorher so viel Armut gar nicht vorstellen können, nicht in der westlichen Hemisphäre. Wenig später war ich in Ostvorpommern. Da braucht ein Krankenwagen möglicherweise auch 90 Minuten bis zu einer alten Frau mit Herzinfarkt. Die Menschen dort stellen sich die gleiche Frage wie in West Virginia: Wozu zahle ich eigentlich Steuern? Andererseits finde ich auch: Bestimmte Sachen kann man nicht einfach so stehen lassen. Etwa, dass Donald Trump immer wieder die Flüchtlingsbewegung nach Deutschland als Negativbeispiel heranzieht, um seine Mauer durchzusetzen. Damit schadet er dem Ansehen Deutschlands in der Welt.
KD: Die USA brauchen ein starkes Europa, das war immer eine Doktrin amerikanischer Außenpolitik. Aber Europa muss auch für sich selbst stärker werden. Interessant ist, wie sehr das Bedürfnis nach europäischer Souveränität gegenüber den USA davon abhängt, wen man fragt. Wenn ich nach Paris fahre, höre ich: Amerika ist kein verlässlicher Partner mehr, wir müssen mehr nach europäischer Autonomie streben, die alten Zeiten sind endgültig vorbei. Dann fahre ich nach Berlin. Dort meint man, das sei doch eher etwas Zyklisches, und mit dem nächsten Präsidenten gehe es bestimmt ein Stück weit zurück zu traditionellerer Zusammenarbeit. Dann fahre ich nach Warschau, und die Polen sagen: Also wir mögen Donald Trump. Außerdem heißt unser Nachbar Russland, und wir sind uns nicht sicher, dass Deutschland und Frankreich uns da verteidigen würden.
Wie könnte man denn hier einen kleinsten gemeinsamen Nenner finden?
KD: Das hängt mit Führungsstärke zusammen, aber auch mit einer Politik der kleinen Schritte. In der Corona-Pandemie werden dazu gerade wichtige Weichen gestellt. Die Wirtschafts- und Finanzkrise, die wir alle gerade erleben, ist größer als alle derartigen Krisen zuvor. Dafür braucht Europa ganz dringend eine gemeinsame Antwort. Schafft es das nicht, werden auch die USA die Europäische Union nicht ernst nehmen.
Herr Nouripour, Ihre Parteivorsitzende Annalena Baerbock hat schon bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar gesagt, Europa sei der größte Binnenmarkt der Erde und solle in handelspolitischen Fragen entsprechend selbstbewusst auftreten. Ist es der richtige Weg, einen Handelskrieg zu provozieren?
ON: Natürlich müssen sich die Europäer gerade in Wirtschaftsfragen einig sein. Schon allein deshalb, weil man sich ausrechnen kann, was passiert, wenn sich die USA überall zurückziehen wie kürzlich aus der Weltgesundheitsorganisation. Diese Lücke wird ganz schnell ausgenutzt werden, und zwar von China. Annalena Baerbock hat insofern völlig recht, als die Europäer sich darauf besinnen müssen, wo sie stark sind: als Wirtschafts- und Wertegemeinschaft. Was sie nicht gemeint hat, ist, dass wir jetzt herumlaufen und mit Handelssanktionen drohen sollten. Denn da zieht man gegen Trump natürlich den Kürzeren. Aber wir sollten auch nicht so tun, als seien wir unserem Schicksal ausgeliefert. Europa kann sehr viel, und wir sollten damit auch selbstbewusst umgehen. Das bedeutet aber nicht «Europe first», sondern internationale Kooperation und eine regelbasierte Weltordnung.
Ein wiederkehrender Konfliktpunkt zwischen den USA und Europa ist das Thema NATO. Trump hat vielfach den europäischen und vor allem den deutschen Beitrag zu dem Bündnis kritisiert, und auch immer wieder anklingen lassen, dass er die Nato verzichtbar findet. In letzter Zeit ist es darum wieder ruhiger geworden. Woran liegt das?
KD: In Bezug auf die NATO gibt es einen ganz klaren überparteilichen Konsens, der so tief verankert ist, dass er sogar Trump ausbremsen würde, wenn der es darauf ankommen ließe. Es ist zwar schwer vorherzusagen, was passiert, wenn Trump wiedergewählt wird. Vielleicht fühlt er sich dann unangreifbar und versucht wirklich, aus der NATO auszusteigen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er dafür eine Mehrheit in seiner eigenen Partei oder gar im Kongress bekäme. Dazu ist dort die Überzeugung dann doch zu groß, dass gute Beziehungen zu Europa auch im amerikanischen Interesse sind.
Herr Nouripour, Sie sind auch im Vorstand der Deutschen Atlantischen Gesellschaft, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Verständnis für die NATO zu vertiefen. Was für ein Verständnis hat die NATO im Jahr 2020 denn eigentlich von sich selbst?
ON: Was in Trump-Zeiten sicherlich eine Herausforderung ist, ist das ungeklärte Verhältnis der USA zu Russland. Aber mal davon abgesehen darf man nicht unterschätzen, was für eine stabilisierende Wirkung die NATO auch für den Zusammenhalt Europas hat. Es gibt überall Gräben – finanzpolitische, energiepolitische, migrationspolitische – und es gibt die Ost-West-Frage: Wer beschützt die baltischen Staaten vor Russland? Sie selbst glauben, dass nur die NATO sie schützen kann, aber nicht die EU. Das sind Ängste, die man verstehen muss.
Wie sollte die transatlantische Kooperation der Zukunft aussehen?
KD: Das hängt wesentlich davon ab, wer die Präsidentschaftswahl im November gewinnt. Der zweite Unsicherheitsfaktor bei der Beantwortung dieser Frage ist die Coronavirus-Pandemie und welche Schlüsse wir daraus ziehen. Entweder wir verstehen, wie wichtig internationaler Zusammenhalt ist, oder die Tendenzen, sich ins Nationale zurückzuziehen, werden noch stärker werden.
ON: Ich glaube, Europa wird auch hier am erfolgreichsten sein, wenn wir zu schätzen wissen, was wir an uns selbst haben. Wir sollten nicht immer nur darüber reden, was alles nicht läuft. Um die Milchquote, die die EU heute leise und effektiv regelt, hätte es vor 200 Jahren Kriege gegeben! In der Friedens- und Konfliktforschung gibt es den Begriff der «Power Projection», den ich sehr schlau finde. Machtprojektion ist das, was passiert, wenn die Russen ein Nuklear-U-Boot für drei Minuten in der Bucht von Stockholm auftauchen lassen – das reicht, dass drei Jahre lang in ganz Skandinavien davon geredet wird. Die EU hat ganz viele – nichtmilitärische – Möglichkeiten, ihre Macht zu projizieren. Vor allem die politische und wirtschaftliche Erfolgsgeschichte der europäischen Integration. Sie macht es nur noch nicht. Das muss sich ändern.
Karen Donfried ist Präsidentin des German Marshall Fund of the United States (GMF), ein Thinktank mit Sitz in Washington, D.C., der sich der Stärkung der transatlantischen Beziehungen widmet.
Omid Nouripour ist außenpolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion. Er ist Mitglied im Vorstand der Atlantik-Brücke und Beisitzer im Vorstand der Deutschen Atlantischen Gesellschaft.
Johanna Roth berichtet als freie Korrespondentin aus den USA, u.a. für Zeit-Online.