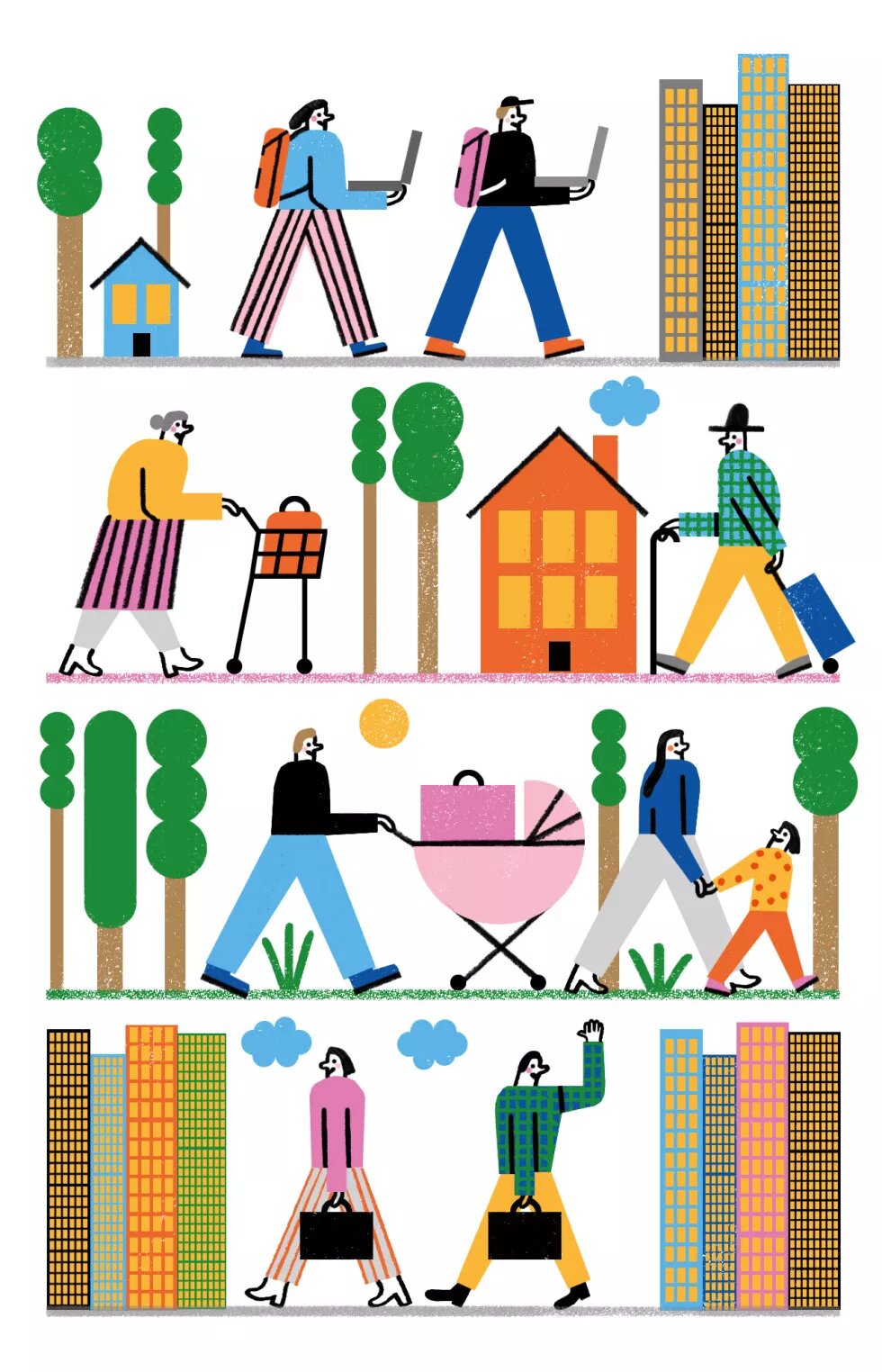Wer in Erfurt über die Krämerbrücke schlendert, fühlt sich im Sommer wie in Italien. Nicht nur wegen der bebauten Brücke, wie es sie sonst nur in Venedig und Florenz gibt, sondern auch wegen des Treibens auf der Straße. 213.000 Einwohner/innen zählte die thüringische Landeshauptstadt Ende 2017. Fünfzehn Jahre zuvor war Erfurts Einwohner/innenzahl auf unter 200.000 gesunken. Thüringens Metropole boomt also. «Erfurt ist das neue Berlin» lautete vor zwei Jahren sogar eine Schlagzeile der Tageszeitung Die Welt.
Oder ist Leipzig, seit einiger Zeit auch als Hypezig betitelt, das neue Berlin? Sind es Dresden oder Jena, Potsdam oder Rostock? All diesen ostdeutschen Städten gemeinsam ist: Sie wachsen. Und sie sind die Gewinner einer umfassenden demografischen Untersuchung, die das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung im Januar 2016 unter dem Titel «Im Osten auf Wanderschaft» vorgestellt hat.
Blühende Städte statt blühende Landschaften
Nicht nur Schlagzeilen wie die von Erfurt als neuem Berlin brachte diese Studie hervor, sondern auch ein gewisses Erstaunen darüber, wie der Osten gegenüber dem Westen aufgeholt hat. «Auf in den Osten» titelte die Berliner Zeitung, und die Süddeutsche zog gleich mit: «Geh doch rüber». Tatsächlich ergab die Studie, dass die Abwanderung aus den neuen Bundesländern – mit einem Bevölkerungsverlust von insgesamt 1,8 Millionen Menschen seit der Wende – gestoppt war. Erstmals zog es mehr Menschen aus dem Ausland und den alten Bundesländern nach Ostdeutschland als von dort fortgingen. «Seit der Wiedervereinigung hing dem Osten ein schlechtes Image an», erklärten die Autoren der Studie, Theresa Damm und Manuel Slupina. «Wer kann, der geht in den Westen – so hatte es lange den Anschein. Dass jetzt auch viele Studienanfänger aus den westdeutschen Bundesländern nach Leipzig, Dresden oder Jena gehen, ist ein Erfolg für diese Städte.»
Das war die gute Nachricht. Die schlechte: Nur 15 Prozent der 2695 ostdeutschen Kommunen profitierten von dieser Trendumkehr.
In den übrigen 85 Prozent ging die Abwanderung weiter. Mit dem einen Unterschied: Nicht mehr nur nach Stuttgart und München zog es die zumeist jungen Menschen, die ihre Dörfer verließen, sondern auch in die ostdeutschen Großstädte. Blühende Städte statt blühende Landschaften: Damit gleichen sich die demografischen Entwicklungen in Ost und West langsam an.
Wer wandert wohin?
Es ist nicht nur regional eine höchst unterschiedliche Wanderung, die Damm und Slupina ausgemacht haben, sondern auch altersmäßig. So zieht es die sogenannten Bildungswanderer und Berufswanderer naturgemäß in die Großstädte. Die Ersten sind zwischen 18 und 24 Jahre alt und offenbar regional sehr verbunden, denn 40 Prozent von ihnen haben sich für eine ostdeutsche Großstadt entschieden. Wenn es nach Ausbildung oder Studium um einen Arbeitsplatz geht, ziehen die Berufswanderer von 25 bis 29 ebenso in die größeren Städte, allerdings mehr noch in die alten als in die neuen Bundesländer.
Ein Ende nimmt die Landflucht erst bei den sogenannten Familienwanderern. Bei ihnen haben die Forscher des Berlin-Instituts festgestellt, dass sie sich vor allem in der vertrauten Umgebung niederlassen. Hier sind Kleinstädte und ländliche Regionen oft attraktiver als Großstädte. Allerdings darf die Distanz zu diesen nicht allzu groß sein.
Wenn die Kinder aus dem Haus sind, spüren viele den Wunsch, in eine kleinere Wohnung zu ziehen. Allerdings wirkt sich diese Empty-Nest-Wanderung nicht so sehr auf das demografische Geschehen aus wie andere Wanderungen. Das Gleiche gilt für die Ruhestandswanderer. Bei beiden aber lässt sich sagen, dass im Zweifel Mittel- und Oberzentren besser abschneiden als die Großstädte. Denn kleinere Städte haben den Vorteil, in der Region bleiben zu können und Grundversorgung, etwa bei Arztpraxen oder kulturellen Einrichtungen, bieten zu können.
«Tendenziell», so fasst Reiner Klingholz, der Leiter des Berlin-Instituts, seine Studie zusammen, «ziehen die Jungen in Richtung der Ausbildungsstätten in den Städten, die Berufswanderer der Arbeit nach, die Familiengründer ins grüne Umland der Zentren, um dann später, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder der Ruhestand beginnt, die Eigenheimsiedlungen wieder in Richtung einer zentralen Lage zu verlassen.»
Die neue Attraktivität der ostdeutschen Städte ist auch das Ergebnis von Anstrengungen: Viele zu DDR-Zeiten vernachlässigte Innenstädte wurden saniert, es gab Fördermittel für die Instandsetzung von Plätzen und ganzen Stadtquartieren, die Infrastruktur ist auf dem neuesten Stand. In den ländlichen Regionen dagegen ist davon nicht viel angekommen – und das betrifft nicht nur die in Ostdeutschland vielerorts schlechte Abdeckung mit schnellem Internet.
Um künftig neben den Städten auch die Dörfer attraktiver zu machen, müsste laut Manuel Slupina verstärkt das bürgerschaftliche Engagement unterstützt werden.
Es ist interessant zu beobachten, dass man auch in einem schrumpfenden Umfeld immer wieder kleinste Dörfer findet, die wachsen, erklärt Slupina. «Das sind oft die, die ein reges Vereinsleben haben oder ein ausgeprägtes zivilgesellschaftliches Engagement. Bürgerbusse, Pflegenetzwerke, Kulturscheunen oder selbstverwaltete Dorfläden wie in Seddin: Das sind Modelle, die ankommen und einer Abwärtsspirale entgegenwirken können.»
Die größte Ressource hier sind die Menschen. Sie wollen zusammenarbeiten.
Während Brandenburg vor allem von Berlin profitiert, ist es in Thüringen die Siedlungsstruktur, die mehr und mehr ein Netz der Stabilität bildet, erklärt Marta Doehler-Behzadi. «Wir haben keine Metropole wie Brandenburg mit Berlin oder Sachsen mit Leipzig», sagt die ehemalige Geschäftsführerin der Internationalen Bauausstellung Thüringen. «Stattdessen haben wir eine einmalige Siedlungsstruktur mit vielen Dörfern, kleinen und mittleren Städten, dazu noch Erfurt, Jena und Gera als Großstädte. All das zusammen mit der wunderbaren Landschaft und den Burgen ist nicht nur identitätsstiftend, es ist für Thüringen auch ein Alleinstellungsmerkmal.»
Das Schwarzatal ist eine dieser lieblichen Landschaften Mitteldeutschlands. Es liegt im Süden Thüringens, viele sind in den vergangenen 25 Jahren abgewandert. Eine Nachwende-Peripherie, in der die Zivilgesellschaft aber noch intakt ist, weiß Ulrike Rothe, die als Projektleiterin bei der IBA für das Schwarzatal zuständig war. «Die größte Ressource hier sind die Menschen. Sie wollen zusammenarbeiten.» Also versuchen die Dörfer und Städte entlang der Schwarza und Saale sich so autark wie möglich zu machen. Für Burkhardt Kolbmüller ist das auch die Chance, einen Stimmungsumschwung zu erzeugen. «Da ist viel positive Energie im Spiel», sagt der Kulturwissenschaftler, der das IBA-Projekt «resilientes Schwarzatal» mit angeschoben hat. Partizipation ist hier das Thema – und auch regenerative Energien.
Einen ganz anderen Vorschlag für periphere Regionen hat das Berlin-Institut in der Schublade. Bisher, erklärt Institutschef Klingholz, würden Flüchtlinge, die infolge des Verteilungsschlüssels in ländlichen Regionen untergebracht seien, in die nächstgelegenen Städte weiterziehen. «Wenn die Gemeinschaft in den Orten alles daransetzen würde, den vorübergehend Zugewanderten persönliche Kontakte, Arbeitsplätze, eine dauerhafte Bleibe, also eine gelebte Integration zu sichern», so Klingholz, könne man die neuen Bewohner halten.
Die Willkommenskultur vor Ort entscheidet damit auch über die demografische Zukunftsfähigkeit der Gemeinden.
Wie Zuwanderung neue Stabilität auch in den entlegendsten Regionen sichern kann, dafür ist die Uckermark im nordöstlichsten Zipfel von Brandenburg ein Beispiel. Durch Zuwanderer aus Stettin, meist sind es junge Familien, konnten Schulen vor der Schließung bewahrt werden. Polen übernehmen Geschäfte und Arztpraxen. «Inzwischen sind zwölf Prozent der Bewohner im Amt Gartz Polen», sagt Amtsdirektor Frank Gotzmann, «in manchen Dörfern machen sie fast die Hälfte der Bevölkerung aus.»
Wenn Erfurt das neue Berlin ist, ist die polnische Uckermark die neue Hoffnung der Peripherie.
Uwe Rada, 1963 in Göppingen geboren, schreibt als Journalist viel über Stadtentwicklung und ist Autor diverser Bücher (u.a. zuletzt der Roman «1988», 2017). Er lebt in Berlin-Pankow und im brandenburgischen Grunow.