
Grüne Argumente bauen auf das Ökologische, sie bauen auf das Soziale. Doch was bedeutet das genau? Der Eröffnungsbeitrag zur Konferenz "Die öko-soziale Frage: Auf der Suche nach der grünen Erzählung".
Dass es in grüner Politik ganz zentral um das Ökologische und das Soziale geht, also um das Verhältnis zur Natur sowie zur Art und Weise des gesellschaftlichen Zusammenlebens, leuchtet den meisten spontan ein. Nimmt man noch die demokratische Frage hinzu - politische Teilhabe, Mitbestimmung, Bürgerrechte, Rechtsstaatlichkeit – hat man das magische Dreieck grüner Politik zusammen. Traditionell kommt noch ein vierter Eckpfeiler dazu: Zivile Konfliktlösung als Maxime internationaler Politik wie des eigenen Handelns, auch wenn "Gewaltfreiheit" spätestens seit Mitte der 90er Jahre nicht mehr als radikaler Pazifismus definiert wird.
Zwischenzeitlich gab es immer mal wieder Anläufe, diesen Kanon grüner Grundwerte neu zu definieren oder zu erweitern. Prominente Beispiele sind der "erweiterte Gerechtigkeitsbegriff" des grünen Grundsatzprogramms sowie der Versuch, grüne Politik um die Achse Selbstbestimmung respektive Freiheit zu zentrieren. So richtig hat das meinem Eindruck nach aber nicht verfangen. Es wäre ein lohnendes Unterfangen, sich auch mit dem Spannungsverhältnis von Ökologie und Freiheit genauer zu befassen.
Sachzwangpolitik in Grün
Ökologie ist ja keineswegs per se eine freiheitliche Angelegenheit. Sie kann ganz unschön autoritär daher-kommen, immer unter Berufung auf die Rettung der Menschheit vor dem drohenden Untergang und auf die unerbittliche Logik biophysikalischer Prozesse: "Mit dem Klima lässt sich nicht verhandeln", wie es im Jargon des ökologischen Naturalismus heißt. Will sagen: der Klimawandel diktiert uns, was wir zu tun und zu lassen haben, basta. Aufgabe der Politik ist es, umzusetzen, was uns die Naturwissenschaften vorgeben, um die Erderwärmung in erträglichen Maßen zu halten.
Man könnte das auch Sachzwangpolitik in Grün nennen. Ihr naheliegendes Instrumentarium sind Verbote, Gebote, Verordnungen. Je mehr die Erderwärmung voranschreitet, desto weniger können wir auf Aufklärung und Freiwilligkeit setzen: dann muss der Staat die notwendigen Gegenmaßnahmen verordnen. Wie passt diese Logik mit einer Politik der Freiheit und Selbstbestimmung zusammen, wenn unter Freiheit mehr verstanden wird als die berühmte Einsicht in die Notwendigkeit (frei nach Friedrich Engels)?
Die Antwort auf diese Frage hängt eng mit unserem Verständnis ökologischer Politik zusammen. "Die Natur" oder eben auch "die Ökologie" als Lehre von den Naturkreisläufen ist für sich noch keine normative Kategorie, aus der eine bestimmte Politik folgen würde. Sie wird es erst mit Bezug auf die menschliche Zivilisation, womit wir wieder bei der sozialen Frage und bei unserem Verständnis von Freiheit und Gerechtigkeit sind. Und auch ökologische Politik dreht sich immer um Alternativen – die Behauptung, dieses oder jenes sei "alternativlos", ist das Ende von Politik.
Ich hoffe, wir werden darauf noch im Laufe der Tagung zu sprechen kommen, wenn es um das grüne Verständnis ökologischer Politik geht.
Mit der Kombination von "sozial" und "ökologisch" tun wir – die Grünen – uns leichter, zumindest auf den ersten Blick. Während der Freiheitsdiskurs unter latentem Neoliberalismus-Verdacht steht, fühlen sich die Grünen pudelwohl, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht. Als langjähriger Teilnehmer an grünen Parteitagen hat man manchmal den Eindruck, dass vielen das soziale Hemd näher sitzt als der ökologische Rock. Bei Debatten um das bedingungslose Grundeinkommen, Hartz IV oder Umverteilungspolitik gehen die Emotionen hoch; soziale Grundsicherung und der Ausbau von Kita-Plätzen sind Herzensthemen der Partei. Und "öko" sind wir sowieso.
Gleiche Lebenschancen künftiger Generationen
Tatsächlich gibt es gute Gründe, beides zusammenzudenken. Eine ökologische Politik, die das Soziale aus den Augen verliert, hat keine Chance auf Mehrheitsfähigkeit. Und eine Sozialpolitik, die nicht die Dimension ökologischer Nachhaltigkeit einbezieht, ist auf Sand gebaut. Auch können alle, die im Gerechtigkeitsdiskurs einigermaßen geschult sind, aus dem Stand heraus begründen, weshalb Ökologie eine Gerechtigkeitsfrage ersten Ranges ist: Es geht, erstens, um die gleichen Lebenschancen künftiger Generationen, also um Generationengerechtigkeit.
Zweitens geht es um einen gerechten Ausgleich zwischen dem hochindustrialisierten Norden, der bisher den Löwenanteil natürlicher Ressourcen konsumiert und den Löwenanteil an Emissionen produziert hat, und den Entwicklungsländern, die am stärksten unter Klimawandel und anderen ökologischen Krisen leiden. Drittens hat die ökologische Frage auch eine innergesellschaftliche Gerechtigkeitsdimension: auch hier sind es die sozial Unterprvilegierten, die am stärksten unter den Folgen des ökologischen Raubbaus leiden. Sie wohnen in der Regel in den Gegenden mit der höchsten Luftverschmutzung und dem meisten Verkehrslärm, in ihrer Nachbarschaft finden sich Mülldeponien und Kohlekraftwerke, sie haben am wenigsten die Möglichkeit, den Umweltbelastungen vor Ort zu entkommen – sei es durch Flucht in ferne Urlaubsparadiese oder durch Umzug in Quartiere, in denen die Welt noch in Ordnung zu sein scheint.
Also alles in schönster Harmonie zwischen ökologischen und sozialen Anliegen? Nicht ganz. Ab und zu stolpern wir doch über die latenten Konflikte, die zwischen beiden Sphären bestehen. Ein Beispiel war die berühmte Forderung des Magdeburger Parteitags von 1998, den Benzinpreis schrittweise auf 5 DM pro Liter zu erhöhen. Geht man nach der reinen Lehre, wonach die Preise gefälligst die ökologische Wahrheit zu sagen haben, war das völlig gerechtfertigt. Aber der Sturm der Entrüstung, der daraufhin nicht nur von der BILD-Zeitung angefacht wurde, sitzt der Partei bis heute in den Knochen. Sie ist seither auf ihrem ureigenen Feld einer ökologischen Steuer- und Abgabenpolitik sehr vorsichtig geworden.
Offenkundig besteht zwischen ökologischen und sozialen Anliegen eben doch keine prästabilisierte Harmonie. Das zeigt sich auch an anderen Beispielen: Treibt man etwa die Forderung nach ökologischer Gebäudesanierung über das rentierliche Maß hinaus, bei dem die erforderlichen Investitionen durch eingesparte Heizkosten ausgeglichen werden, treibt man die Mieten hoch oder jagt einen relevanten Teil der Hausbesitzer auf die Barrikaden.
Die Spannung zwischen Ökologie und Sozialem hat viele Gesichter. Das gilt auch für die grüne Erzählung von gesunder Ernährung und biologischer Landwirtschaft. Sicher, man kann sich ökologisch vorbildlich und dennoch preisgünstig ernähren, wenn man auf Fleisch verzichtet und dem Rhythmus der Jahreszeiten folgt, sich also auf saisonale Produkte aus der Region beschränkt. Dann fallen auch die höheren Preise für Öko-Lebensmittel nicht ins Gewicht. Aber gerade in den ärmeren Bevölkerungsschichten gilt eine solche Ernährungsweise als Zumutung. Es sind vor allem die gut verdienenden akademischen Mittelschichten, die im Bio-Supermarkt einkaufen und die Vorzüge einer kulinarisch anspruchsvollen Öko-Küche entdeckt haben – eben das "postmaterielle" Milieu, das die grüne Stammwählerschaft bildet. Wer also den Grünen empfiehlt, sich als "Partei der gesunden Ernährung" zu profilieren, muss sich über den sozialen Bias Gedanken machen, der diesem Thema anhängt.
Postwachstum in Industriegewerkschaften
Das gilt auch für die neuerdings wieder sehr beliebte "Postwachstums"- Debatte, die im Wirtschaftswachstum die Wurzel allen Übels sieht. Abgesehen davon, dass die Forderung nach "Degrowth" voll in der quantitativen Logik bleibt, also die zentrale Frage nach der Art und Weise industrieller Produktion, Energieerzeugung, Mobilität, Städtebau etc. verfehlt - sie führt auch unvermeidlich in Konflikt mit sozialen Anliegen. Wen wundert es, dass die Mehrheit der Bevölkerung empfindlich reagiert, wenn sie den Eindruck hat, die Ökos wollten ihnen den Billigurlaub im Süden verkümmeln, das Autofahren immer teurer machen oder gar strikte Regeln aufstellen, wie viel Wohnfläche pro Kopf erlaubt ist, um den Flächen- und Energieverbrauch einzudämmen?
Woher kommt es wohl, dass die Industriegewerkschaften nicht auf den Postwachstums-Diskurs aufspringen? Sie können eben nicht ignorieren, dass in einer dauerhaft schrumpfenden Ökonomie auch das Beschäftigungsniveau, die Einkommen und Renten sinken werden, und das löst bei ihren Mitgliedern zu Recht Sorgen aus. Auch die grünen Forderungen nach einem Ausbau des Sozialstaats, mehr Geld für die Bildung und höheren Investitionen in die öffentliche Infrastruktur passen nicht recht zu einer Anti-Wachstumspolitik. Steigende Staatsausgaben und sinkende Wirtschaftsleistung gehen auf Dauer nicht zusammen, soviel programmatische Klarheit muss sein.
Wie man auch immer zu diesen Fragen steht: je stärker wir die ökologische Transformation der Wirtschaft, des Energiesystems oder des Städtebaus vorantreiben, desto mehr Gedanken müssen wir uns über die sozialen Wechselwirkungen machen. Welche Verteilungswirkungen haben z.B. höhere Ressourcensteuern und wie können wir gegebenenfalls steigende Kosten für die ärmeren Bevölkerungsschichten kompensieren? Soll das Wohngeld künftig auch Mehrkosten aus der Wärmesanierung abdecken? Anderes Beispiel: Wenn das Autofahren teurer wird, braucht es erst recht ein erschwingliches, modernes öffentliches Verkehrsangebot und gut ausgebaute Fahrradwege in der Stadt. Und wenn es um die Energiewende geht, müssen wir darauf achten, dass die Kostendegression bei Solar- und Windenergie und die sinkenden Börsenstrompreise auch bei den privaten Haushalten ankommen.
Verteilungsgerechtigkeit ist wichtig, um Akzeptanz für ökologische Veränderungen zu schaffen. Aber sie kann sich nicht in der gerechten Verteilung des "Weniger" erschöpfen. Wir sollten den ökologischen Umbau der Industriegesellschaft nicht als eine Geschichte von Einschränkungen, Verzicht und Verboten erzählen, sondern als eine Fortschrittsgeschichte, die auch neue Chancen für sozialen Aufstieg, zukunftsfähige Jobs und nachhaltigen Wohlstand eröffnet. Nur so können wir eine breite Allianz für den ökologischen Wandel bilden, die auch diejenigen mitnimmt, die nicht im Wohlstand schwimmen.
Videomitschnitt des Eröffnungsbeitrages
Die öko-soziale Frage - Auf der Suche nach der grünen Erzählung II - Begrüßung Ralf Fücks - Heinrich-Böll-Stiftung
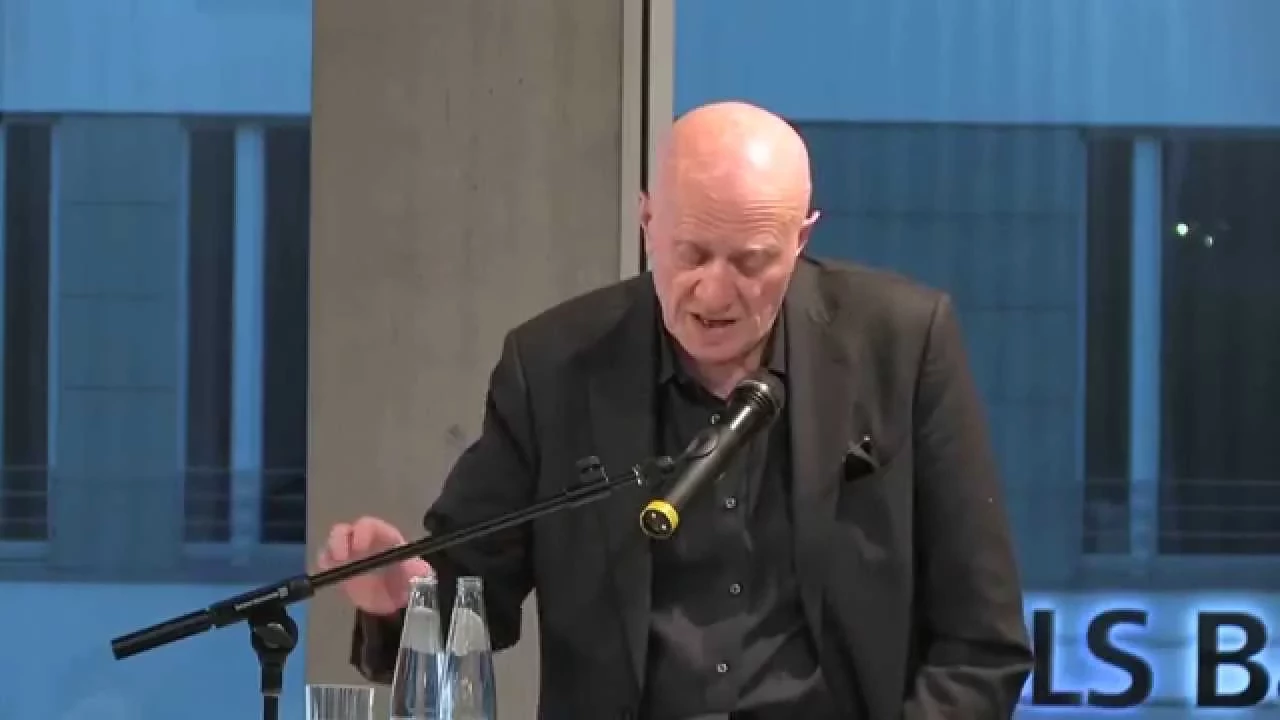 Direkt auf YouTube ansehen
Direkt auf YouTube ansehen

