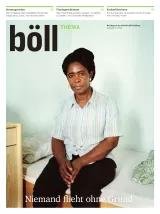Das Dublin-System hat Europas Asylpolitik ins Chaos gestürzt. Jetzt soll es reformiert werden. Aber wie?
Manchmal kann große Politik ganz einfach sein. Ein simpler Dreisatz reicht. Zum Beispiel bei der Frage, wie Flüchtlinge innerhalb Europas am besten verteilt werden sollten. Die gegenwärtige Regelung ist als Dublin-Verordnung bekannt. Sie gilt seit 1990 und besagt im Kern: Das Land, über das ein Flüchtling in die EU kommt, ist für ihn zuständig. Geht der Flüchtling trotzdem in ein anderes EU-Land, wird er zurückgeschoben. Wer außer den Flüchtlingen dabei das Nachsehen hat, liegt auf der Hand: die Staaten an den EU-Außengrenzen. Nach 2000 brach das Asylsystem vor allem in Griechenland, Malta und Italien deshalb zusammen – mit katastrophalen Folgen für die Flüchtlinge.
Länder wie Deutschland hielten gleichwohl an dem Verfahren fest. "Dublin II bleibt selbstverständlich erhalten", sagte der Exbundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU), als nach der Schiffskatastrophe von Lampedusa 2013 die Kritik an der Regelung einen vorläufigen Höhepunkt erreichte. Das System habe sich "bewährt". Jetzt ist das plötzlich anders. "Wir müssen uns verständigen auf Aufnahmequoten etwa nach Einwohnern", sagte Friedrichs Nachfolger Thomas de Maizière bei der EU-Innenministerkonferenz am 9. Oktober 2014 in Luxemburg. Genau das hatten die Länder Südeuropas seit Jahren verlangt. Jedes Mal waren sie dabei am Widerstand vor allem aus Berlin gescheitert. Was ist geschehen?
Die Statistik bietet Aufschluss: "Aufnahmequoten nach Einwohnern" würde bedeuten, dass Deutschland etwa 16 Prozent aller Asylbewerberinnen und -bewerber in der EU aufnehmen muss. Konsensfähiger wäre wohl ein Mix aus Wirtschaftskraft und Einwohnerzahl, etwa im Verhältnis 2:1. Ähnlich berechnet sich auch der Königsteiner Schlüssel, der die Verteilung von Flüchtlingen innerhalb Deutschlands auf die 16 Bundesländer regelt. So müsste Deutschland derzeit etwa 21 Prozent aller Flüchtlinge in der EU aufnehmen. Also deutlich mehr, als wenn es nach der Zahl der Einwohner ginge.
Auf einmal entdeckte Deutschland die Nachteile des Dublins-Systems
Wie sah es bislang aus? Dadurch, dass die meisten Flüchtlinge per Gesetz an die Länder der Außengrenzen gebunden waren, entfielen auf Deutschland lange Zeit nur relativ wenige der Asylanträge in der EU. Rund 11 Prozent etwa waren es bis 2009 – also deutlich weniger, als Deutschland bei einem Quotensystem aufnehmen müsste. Doch seitdem wächst dieser Anteil: 2011 war es ein Fünftel, 2012 ein Viertel, von Mitte 2013 bis Mitte 2014 wurde EU-weit jeder dritte Asylantrag in Deutschland gestellt. Lange hatte Deutschland von der Regelung profitiert. Justament als sich das änderte, entdeckt es auf einmal die Nachteile an dem angeblich "bewährten" Dublin-System.
Wird jetzt also alles gut? Mitnichten. Zum einen konnten sich die EU-Staaten bislang nicht auf eine solche Quotenregelung einigen. Zum anderen hätte diese erhebliche Tücken. Zwar würden Länder, die bislang besonders wenige Flüchtlinge aufnehmen, zu mehr Engagement gezwungen. Das beträfe viele osteuropäische Staaten, aber auch Portugal, Spanien oder Irland. Dadurch würden EU-weit wohl insgesamt mehr Flüchtlinge aufgenommen werden können. Hinzu könnte kommen: Das geltende System hat die Aufnahmestandards in den Ländern, die besonders belastet waren, fallen lassen – teils ins Bodenlose. Malta, Griechenland, Polen, Ungarn und Zypern setzen auf Abschreckung durch Internierung, Italien überlässt die Flüchtlinge fast vollkommen sich selbst.
Gerichte in vielen EU-Staaten haben deshalb zuerst Rückschiebungen nach Griechenland und zuletzt immer häufiger auch nach Italien verboten. Das war eine der Ursachen, warum die Anträge zum Beispiel in Deutschland gestiegen sind. Eine Quote würde die völlige Überlastung einzelner Länder beenden. Sie könnten die Bedingungen der Flüchtlingsaufnahme verbessern.
Doch ob das geschieht, ist fraglich. Seit 2013 verpflichtet die EU zwar alle Mitgliedsstaaten auf einheitliche Aufnahmestandards. Doch dieser Anspruch wird vielerorts in absehbarer Zeit nicht eingelöst werden. Selbst de Maizière hat deswegen vorgeschlagen, bestimmte Länder für eine Übergangsphase von einer Quotenregelung auszunehmen. Diese bedürfte zudem einer EU-Behörde, die noch zu schaffen wäre.
Der Vorschlag ist nicht neu. Er kam in der vergangenen Legislaturperiode des EU-Parlaments mehrfach auf, allerdings modifiziert: Bei "qualifiziertem Interesse" sollen Flüchtlinge das Land ihres Asylantrags selbst bestimmen können. "Qualifizierte Interessen" könnten etwa Sprachkenntnisse oder Verwandte sein. Das ginge zu Lasten der Exkolonialmächte Großbritannien oder Frankreich, aber auch von Staaten mit großen Exilcommunities wie Deutschland oder Schweden. Es wäre denkbar, eine Kappungsgrenze einzuziehen: Zuweisungen nach "qualifiziertem Interesse" wären dann nur so lange möglich, bis die Sollaufnahme eine Landes um einen bestimmten Faktor
überschritten wird.
So oder so: Manche Länder müssten mehr, andere weniger nehmen. Eine finanzielle Umlage wäre nötig: Die überproportional belasteten EU-Mitglieder bekämen Geld von den übrigen. Doch all dies würde das Kernproblem der Quotenregelung nicht aus der Welt schaffen: Die individuellen Interessen der Asylsuchenden werden nur im Ausnahmefall berücksichtigt. Sie könnten gegen ihren Willen in Länder verteilt werden, deren Sprache sie nicht sprechen, in denen sie niemanden kennen, die sie schlecht behandeln, die keine Aussicht auf Asylanerkennung oder einen Job bieten. Genau wie heute. Pro Asyl nennt die Quote deshalb ein "inhumanes, technokratisches Zwangsverteilungsprogramm".
Das Prinzip der freien Wahl wäre gerechter als das geltende System
Der zweite Ansatz für eine Reform des Dublin-Systems ginge weiter. Er ließe den Flüchtlingen freie Wahl, wo sie ihren Antrag stellen wollen. Die Mitgliedsstaaten blieben verpflichtet, irregulär einreisende Migranten beim Grenzübertritt zu registrieren. Damit diese vor der direkten Zurückschiebung geschützt seien, obwohl sie keinen Asylantrag stellten, müssten sie sich als Asylsuchende melden. Der Einreisestaat hätte dem Flüchtling eine schriftliche Bestätigung über diese Meldung auszustellen. Diese würde ihn zur Weiterreise in den EU-Mitgliedsstaat seiner Wahl berechtigen. Flüchtlinge könnten so in dem Land, wo ihre Familien, ihre Communities leben, ihre Asylanträge stellen. Das wäre effizienter als das tausendfache Zwangsverfrachten der Flüchtlinge.
Die Vorsitzende des Sachverständigenrats Migration, Christine Langenfeld, hat ein solches Prinzip kürzlich gleichwohl als "Beginn der Renationalisierung der Flüchtlingspolitik" abgelehnt. Die Konsequenzen würden "auf dem Rücken der Flüchtlinge ausgetragen". Tatsächlich könnten besonders beliebte Staaten versucht sein, Schutzstandards abzusenken – so, wie Deutschland es 1993 mit dem "Asylkompromiss" getan hat. Doch anders als 1993 gibt es heute Vorschriften für EU-weit einheitliche Aufnahmestandards. Diese müssten von der EU-Kommission strikt durchgesetzt werden.
Gleichzeitig bedürfte es eines effektiven finanziellen Ausgleichsfonds. Das Prinzip der freien Wahl würde jedoch die überproportionalen Belastungen weniger stark ins Gewicht fallen lassen, weil die Flüchtlinge durch familiäre, soziale und kulturelle Netzwerke besser integriert wären. Gerechter als das geltende System wäre dies allemal – und menschenrechtskonformer sowieso.
Dieser Text erschien in dem Böll.Thema 3/2014: "Niemand flieht ohne Grund".