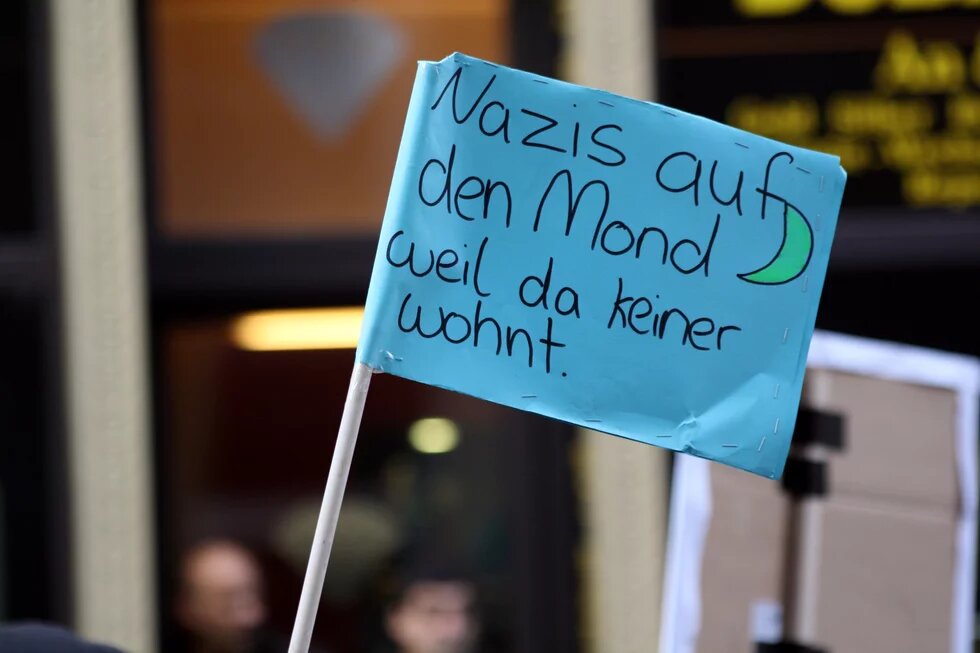
Anfang 2014 wurde die Bund-Länder-Fachkommission "Ideologien der Ungleichwertigkeit und Neonazismus in Deutschland" vom Verbund der Heinrich-Böll-Stiftungen ins Leben gerufen. Schwerpunkt ihrer Arbeit sind die Analyse von rassistischen Grundierungen in der Gesellschaft.
Mit Beginn des Jahres 2014 wurde die Bund-Länder-Fachkommission „Ideologien der Ungleichwertigkeit und Neonazismus in Deutschland“ vom Verbund der Heinrich-Böll-Stiftungen ins Leben gerufen. Schwerpunkt der Kommissionsarbeit sind die Analyse von - im weitesten Sinne - rassistischen Grundierungen in der Gesellschaft, anderen Ideologien der Ungleichwertigkeit und die bisherigen Ansätze der Arbeit an diesen Einstellungen und Handlungen. Bei der Zusammenarbeit der Kommissionsmitglieder wurde sehr schnell klar, dass der Fokus zur Bekämpfung von Ideologien der Ungleichwertigkeit nicht auf die Ränder, sondern auf Mechanismen in der gesamten Gesellschaft gelegt werden muss. Aus diesem Grund werden Arbeitsansätze für eine menschenrechtsorientierte Entwicklung demokratischer Kultur reflektiert, die alle gesellschaftlichen Gruppen in den Blick nehmen.
Die Fachkommission bearbeitet und diskutiert unterschiedliche Fragestellungen aus diesem Themenkomplex und veröffentlicht im Laufe ihrer Arbeit mehrere Policy Paper, in denen Diskussionsstände und Empfehlungen für die zukünftige Umsetzung veröffentlicht werden. Es soll erreicht werden, dass politische Entscheider/innen sich mit den Themen befassen und Impulse für eine Weiterentwicklung auf Grundlage bisheriger Erfahrungen aus Praxis und Wissenschaft gegeben werden.
In der Fachkommission arbeitet ein interdisziplinäres Team von Expert/innen aus der Wissenschaft, der praktischen Arbeit und der Politik zusammen. Mitglieder der Kommission sind Dorothea Schütze (Institut für Demokratieentwicklung), Yasemin Shooman (Akademie des Jüdischen Museums Berlin), Betul Yilmaz (Akademie des Jüdischen Museums Berlin), Heike Radvan (Fachstelle Gender und Rechtsextremismus), Monika Lazar (MdB, Bündnis90/Grüne), Stephan Kramer (European Office on Anti-Semitism, American Jewish Committee), Beate Küpper (Lehrstuhl für Soziale Arbeit für Gruppen und Konfliktsituationen, Hochschule Niederrhein), Bianca Klose (Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus, Berlin), Joshua Kwesi Aikins (Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland), Ulli Jentsch (Antifaschistisches Pressearchiv und Bildungszentrum Berlin e.V.), Thomas Hafke (Fan-Projekt Bremen e.V.), Alexander Häusler (Forschungsstelle Rechtsextremismus/Neonazismus der FH Düsseldorf), Friedemann Bringt (Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus), Volker Beck (MdB, Bündnis90/Grüne), Michael Nattke (Kulturbüro Sachsen e.V.), Stefan Schönfelder (Weiterdenken - Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen) und Michael Stognienko (Heinrich-Böll-Stiftung).
Motivation für die Arbeit der Expertenkommission
a) Zäsur durch die Aufdeckung des NSU:
Die Aufdeckung der rassistischen Morde des Nationalsozialistischen Untergrundes (NSU) und die zahlreichen offenen Fragen, die sich aus den Berichten unterschiedlicher Untersuchungsausschüsse ableiten lassen, stellen eine Zäsur dar. Die Ausmaße neonazistischer Gewalt in der Bundesrepublik wurden von der Mehrheitsgesellschaft, die sich in Deutschland überwiegend als weiße, heterosexuelle Dominanzgesellschaft darstellt, und den staatlichen Behörden über Jahrzehnte hinweg unterschätzt, ignoriert oder geleugnet. Trotz des Verweises auf zahlreiche neonazistische Tötungsdelikte, die nicht vom NSU begangen wurden und der aggressiven rassistischen Propaganda extrem rechter Gruppen wurde die Existenz einer neonazistischen Terrororganisation in Deutschland nicht ernsthaft in Erwägung gezogen. Es reicht nicht aus, diese Tatsachen zur Kenntnis zu nehmen und situativ an die rechtsterroristische Mordserie zu erinnern. Es bedarf der selbstkritischen Überprüfung und Weiterentwicklung der Instrumentarien und Methoden, die dazu geeignet sind, Ideologien der Ungleichwertigkeit und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zurück zu drängen. Diese Auseinandersetzung mit den Instrumenten, die bisher genutzt wurden, ist langfristig und tiefgründig zu führen. Die Expertenkommission wird deshalb die in ihr versammelten Expertisen nutzen, um den Fokus auf relevante gesellschaftliche Bereiche zu legen.
Die Rassismusforschung und die Rechtsextremismusforschung sowie die praktische Arbeit gegen Rassismus und Rechtsextremismus sind in Deutschland in der Vergangenheit nebeneinander und mit wenig Bezug aufeinander praktiziert worden. Ziel der Kommission ist es deshalb auch, dass die praktischen Arbeitsansätze und die wissenschaftlichen Erkenntnisse der beiden Bereiche einander besser begegnen. In der Auseinandersetzung mit Ideologien der Ungleichwertigkeit und einer menschenrechtsorientierten Demokratieentwicklung sind die Nutzung von Synergieeffekten und die Bezugnahme auf die unterschiedlichen Stärken für die zukünftige Umsetzung hilfreich.
b) Institutioneller Rassismus in der deutschen Gesellschaft:
Rassismus ist kein gesellschaftliches Randphänomen, sondern konstitutiver Wissensbestand der deutschen Gesellschaft. Auch für diese Tatsache lassen sich anhand der Ergebnisse der NSU-Untersuchungsausschüsse zahlreiche Belege finden. Unabhängig vom NSU-Terror dominiert im Wissenschafts- und Praxis-Diskurs der Mehrheitsgesellschaft die Ansicht, dass sich Rassismus und andere Ungleichwertigkeitsvorstellungen mit Hilfe von Einstellungen der Einzelnen psychologisieren und individualisieren lassen. Migrantenselbstorganisationen und Betroffenengruppen weisen seit Jahren darauf hin, dass diese Erklärung nur ein möglicher Zugang ist, der zwingend durch andere ergänzt und mit ihnen verzahnt werden muss. Ungleichwertigkeitsmechanismen werden aus historischen und familiären Diskursen überliefert, durch hegemoniale Politik in Gesetzen manifestiert und damit zur gesellschaftlichen Normalität erklärt. Die Kategorien des Institutionellen Rassismus und der Institutionellen Diskriminierung bieten eine Perspektive, um die Benachteiligungsstrukturen und Ausgrenzungen sichtbar zu machen, die auf Grundlage von Zugehörigkeitskonstruktionen durch Organisationen (z.B. durch Gesetze, Erlasse, Regeln, Verfahrensweisen), zur Absicherung von Privilegien der Mehrheitsgesellschaft oder durch Mitarbeiter/innen von Organisationen im Rahmen ihrer Arbeit reproduziert werden. Menschen die nicht der Mehrheitsgesellschaft angehören, sind auf Grundlage der Konstruktion ihres „Anders-seins“ nach wie vor massiven Benachteiligungen ausgesetzt. Grundlegende Maßnahmen zur Veränderung dieser Verhältnisse blieben in der Bundesrepublik bisher aus.
c) Diversifizierung von Ideologien der Ungleichwertigkeit:
Darüber hinaus ist zu beobachten, dass Ideologien der Ungleichwertigkeit nach wie vor mehrheitsfähig in der deutschen Gesellschaft sind. Einstellungsstudien zeigen, dass rassistische, antisemitische, heterosexistische und andere Facetten Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in der deutschen Gesellschaft stabil verankert sind. Zudem haben weder Ausstiegsprogramme noch die Konjunkturschwankungen in der organisatorischen Entwicklung des neonazistischen und nationalistischen Milieus dazu beigetragen, dass die Zahl der organisierten Neonazis sich deutlich verringert. Rassistische und heterosexistische Positionen wurden in den letzten Jahren wieder zunehmend salonfähig. An dieser Entwicklung sind unterschiedliche gesellschaftliche Akteure und Gruppen beteiligt.
Auf der Ebene der politischen Parteien lassen sich diese Entwicklungen in Deutschland unter anderem im Aufstieg der Alternative für Deutschland (AfD) beobachten. Bei den letzten Europa-, Kommunal- und Landtagswahlen konnte sich die AfD als stärkste Kraft rechts der CDU etablieren. Auch wenn die Entwicklung der AfD regionale Spezifika aufweist, wird sie vielerorts als nationalchauvinistische Anti-Immigrationspartei gewählt, die heterosexistische Stereotype offen vertritt.
Anhand der Zunahme von antisemitischen Übergriffen, Anschlägen auf Synagogen und israelfeindlichen Demonstrationen im gesamten Bundesgebiet wird zudem ein Erstarken des Antisemitismus deutlich. Im Gewand einer einseitigen und undifferenzierten Kritik am Handeln des Staates Israel oder auf Montagsdemonstrationen von verschwörungstheoretischen Gruppen werden antisemitische Positionen wieder als Meinungen in öffentlichen Debatten diskutiert.
Arbeitsweise der Expertenkommission
In den ersten Sitzungen der Kommission haben sich Fragen zum Selbstverständnis der Kommission gestellt, die sich als grundlegend für die weitere Arbeit darstellen. So wird die Interpretation von Neonazismus und Ideologien der Ungleichwertigkeit, als die „Ränder der Gesellschaft“ abgelehnt. Die Mehrheitsgesellschaft konzentrierte ihre Bemühungen um die Bekämpfung von Ungleichwertigkeit in den letzten Jahrzehnten auf die Bekämpfung von Neonazis. Dieser Ansatz ist nicht falsch, jedoch auch nicht ausreichend. Vielmehr muss es zukünftig um Defizite an Menschenrechtsorientierung innerhalb der gesamten deutschen Gesellschaft gehen. Die Menschenrechte sind dabei ein letzter normativer Horizont auf den sich alle demokratischen, politischen Akteure einigen können. Trotzdem ist ihre Umsetzung ein ständiger Deutungskampf. Sie sind der Politik weder vor- noch nachgeordnet, sondern als deren eigentliches Programm zu verstehen. Menschenrechte können nicht allein per Dekret oder Gesetz erteilt werden, sondern sind Ergebnis eines Selbstermächtigungsprozesses. Sie stellen den Mittelpunkt eines ständigen Demokratisierungsprozesses dar. Demzufolge muss es bei der Frage, wie Ideologien der Ungleichwertigkeit zurück gedrängt werden können, primär darum gehen, wie der Prozess der Selbstermächtigung der Betroffenen von Ungleichwertigkeitsvorstellungen unterstützt werden kann. In der Bundesrepublik gelten die Menschenrechte nicht für alle Menschen an allen Orten und zu allen Zeiten gleich. Es muss darum gehen, wie die Privilegierten ihre Privilegien nutzen, um den Nicht-Privilegierten ihre Rechte zu geben. Dies kann nur in engem Austausch mit den Betroffenengruppen selbst geschehen.
Zur Auseinandersetzung mit Ideologien der Ungleichwertigkeit im Gemeinwesen und den Kommunen vor Ort, der Auseinandersetzung in Schulen und Bildungseinrichtungen, in den Universitäten, der Jugendarbeit, der Politischen Bildung und der Rolle des Staates in diesem Feld, werden wir in den nächsten Monaten Policy Paper veröffentlichen, die sich an die Entscheider/innen in der Politik, die Praktiker/innen im Feld und an den Verbund der Heinrich-Böll-Stiftungen als Adressat/innen richten. Neben den Policy-Papern ist Ende 2015 ein Abschlussbericht der Kommission geplant, der über diese Felder der Auseinandersetzung mit Ideologien der Ungleichwertigkeit hinaus geht.



