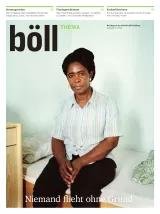Früher galten Flüchtlinge eher als Täter: als Asylbetrüger, Arbeitsplatzdiebe. Heute gelten sie eher als Opfer - und als solche müssen sie ihre Geschichten von der Flucht vereinfachen, bis es passt. Das gilt für das Erstgespräch beim Asylamt ebenso wie für einen Auftritt in der Mediengesellschaft.
Können wir die Schicksale von Flüchtlingen, medial vermittelt, überhaupt begreifen? Anders gefragt: Auf welche schlichten Botschaften muss die Komplexität von Fluchtgründen reduziert werden, um eine hiesige Öffentlichkeit zu erreichen? Und bewirkt diese Vereinfachung am Ende eher Anteilnahme oder Verrohung?
Flucht, Medien, Öffentlichkeit – das ist eine unübersichtliche Landschaft. Zunächst fallen die Kontraste auf. Viel mehr Medien als früher klären auf, stehen sogar Flüchtlingen bei. Reporter nehmen Gefahren und zeitweilige Verhaftung in Kauf, um die Odyssee Flüchtender hautnah ins deutsche Wohnzimmer zu bringen. Zugleich hat selbst tausendfacher Tod im Mittelmeer keine Veränderung der Politik bewirkt. Die Traumata von Flüchtlingen mögen auf den Reportage-Seiten großer Zeitungen ausgebreitet werden, doch morgen können sich die Betroffenen in einem Abschiebegefängnis wiederfinden.
Daraus ist zunächst zu schließen: So wirkmächtig Medien sind, wenn sie Vorurteile und Ressentiments anheizen, so ohnmächtig können sie sein, wenn es um die Veränderung realer Politik geht. Für jene, die auf der Straße um Bleiberecht kämpften, war das eine bittere Erfahrung: Die Proteste von Flüchtlingen waren Thema in allen großen Medien, während die Protestierenden selbst den Eindruck hatten, vor eine Mauer zu laufen. Wieso war es in dieser an Zeitungen, Computern, Smartphones überquellenden Gesellschaft nicht möglich, plausible Forderungen zu verankern? Trügerisch die Hoffnung, eine informierte Öffentlichkeit werde hinreichenden Druck auf politische Entscheidungsträger ausüben. Zwei Jahre Flüchtlingskampf in Berlin mag die Stadt verändert haben, nicht jedoch das Schicksal der Protagonisten.
Das Thema Flucht ist schick geworden
Was bedeutet der Begriff Mediengesellschaft in die sem Fall? Dass die Gutwilligen allenfalls in der Lage sind, ein Mitleid hervorzurufen, das folgenlos bleibt? Oder ästhetisiert wird? Das Thema Flucht ist schick geworden, gut für ambitionierte Filmemacher und Preis-Verleiher. Flucht als Soirée.
Eine Medienszene, die sich in dieser Art von Solidarität gefällt, ist vom klassischen deutschen Stammtisch gewiss weit entfernt. Die althergebrachte Allianz zwischen Politik und Stammtisch in Fragen von Asyl und Einwanderung existiert nach wie vor, und auch sie wird von Medien vermittelt. Für das einfache Volk gibt es den Leitsatz "Deutschland kann nicht alle Armutsprobleme der Welt lösen", und für
das Bildungsbürgertum wurde ein Begriff wie "Mobilitätspartnerschaft" erfunden, womit eine mildtätig kaschierte Verhinderung von Mobilität gemeint ist.
An beiden Beispielen fällt allerdings auf: Die Argumente haben einen Schlag ins Defensive. Auch wer für die Fortsetzung der Festungspolitik plädiert, kann die Realität einer wachsenden Flüchtlingskatastrophe nicht leugnen. Hier folgenloses Mitleid, dort eine Mitleid verweigernde Abwehrhaltung: Beiden gemein ist ein großer Bedarf an Verdrängung. Denn das Wissen um die Toten im Mittelmeer
– 3.200 in den ersten neun Monaten von 2014 – ist ja allseits verfügbar,niemand kann sich auf Nichtwissen berufen, um jeden Gedanken an eine mögliche Mitschuld abzuwehren. Die Mediengesellschaft hat eine Art innere Festung, als Pendant zur äußeren Festungspolitik: die
Abstumpfung.
Ein Blick, der keine Empathie kennt
Auslandsberichterstattung ist heute immer mehr bloße Kriegsberichterstattung. In jeder Nachrichtensendung wird so massenhaft gestorben, dass emotionale Distanzierung die einzig mögliche Reaktion ist. Leid und Leidtragende werden zeitsparend zur Schau gestellt, der Zuschauer eilt daran vorbei, kann nur Voyeur sein. So wird ein Blick auf die Welt antrainiert, der keine Empathie mehr kennt. Nur Angst vor dieser Welt, die noch "da draußen" ist, aber immer näher zu rücken droht. Die Flüchtlinge sind an der Nahtstelle, sie gehören zu denen "da draußen" und zu uns. In der Reaktion auf diese Herausforderung ähnelt die europäische Öffentlichkeit einer schizoiden Persönlichkeit, sie trennt Denken und Gefühl, kann somit jede Menge Flüchtlingsfakten verdauen, ohne sich davon im Wortsinn erschüttern zu lassen.
Und selbst die Berichte der engagiertesten Journalisteninnen und Journalisten vermögen dem Publikum letztendlich nicht begreiflich zu machen, was Flüchtlingen geschieht. Diese Unfähigkeit, zu begreifen, oder richtiger gesagt: die Unmöglichkeit, sich inexistentielle Ausnahmesituationen hineinzuversetzen, empfinden am ehesten jene, die nah dran sind. In einer sizilianischen Kleinstadt, wo viele Migrant/innen ankommen, übernahm die Verwaltungschefin die Vormundschaft für 150 unbegleitete Minderjährige. "Ich kann mir nicht ausmalen", sagte sie, "was Mütter und Väter durchmachen, wenn sie ihr elfjähriges Kind in ein Boot setzen und sagen: Viel Glück!"
Geschichten vereinfachen, bis sie passen
Sich etwas nicht ausmalen können – das ist ein Satz, der die Regeln der Mediengesellschaft verweigert. Muss nicht alles vermittelbar sein? Um den Preis, es so lange zu vereinfachen, bis es passt? So wurden früher Flüchtlinge zu Tätern: Asylbetrügern, Arbeitsplatzdieben. Heute sind sie eher Opfer. Als Opfer müssen sie klar, einfach, flach und widerspruchsfrei sein, das gilt für das Erstgespräch beim Asylamt ebenso wie für einen Auftritt in der Mediengesellschaft.
Aber Flucht und Migration sind komplexe Angelegenheiten von komplexen Menschen. Jemand war drei Jahre nach Europa unterwegs, um dann in der "Abendschau" Zeit für den Satz zu haben: "In meinem Land kann man nicht leben." Ein schlechter, falscher Satz, denn in seinem Land wollen keines wegs alle weg. Aber zu sagen, er habe eine Entscheidung getroffen, das wäre riskant. Dann wäre er nicht das simple, flache Opfer.
Flüchtlinge müssen falsche Dinge sagen, um gehört zu werden. Und sie müssen Dinge tun, die sie zu Hause nicht täten: Dächer besetzen, auf der Straße schlafen. Und doch bleibt eine Mauer. Seltsam: Um die Mediengesellschaft in Erregung zu versetzen, reichen fünf alte Feuerwehrwesten mit der Aufschrift "Sharia-Polizei". Um diese Gesellschaft zu berühren, reichte es nicht aus, vor dem Brandenburger Tor im Eisregen einen Hungerstreik zu machen.
Dieser Text erschien in dem Böll.Thema 3/14: "Niemand flieht ohne Grund".